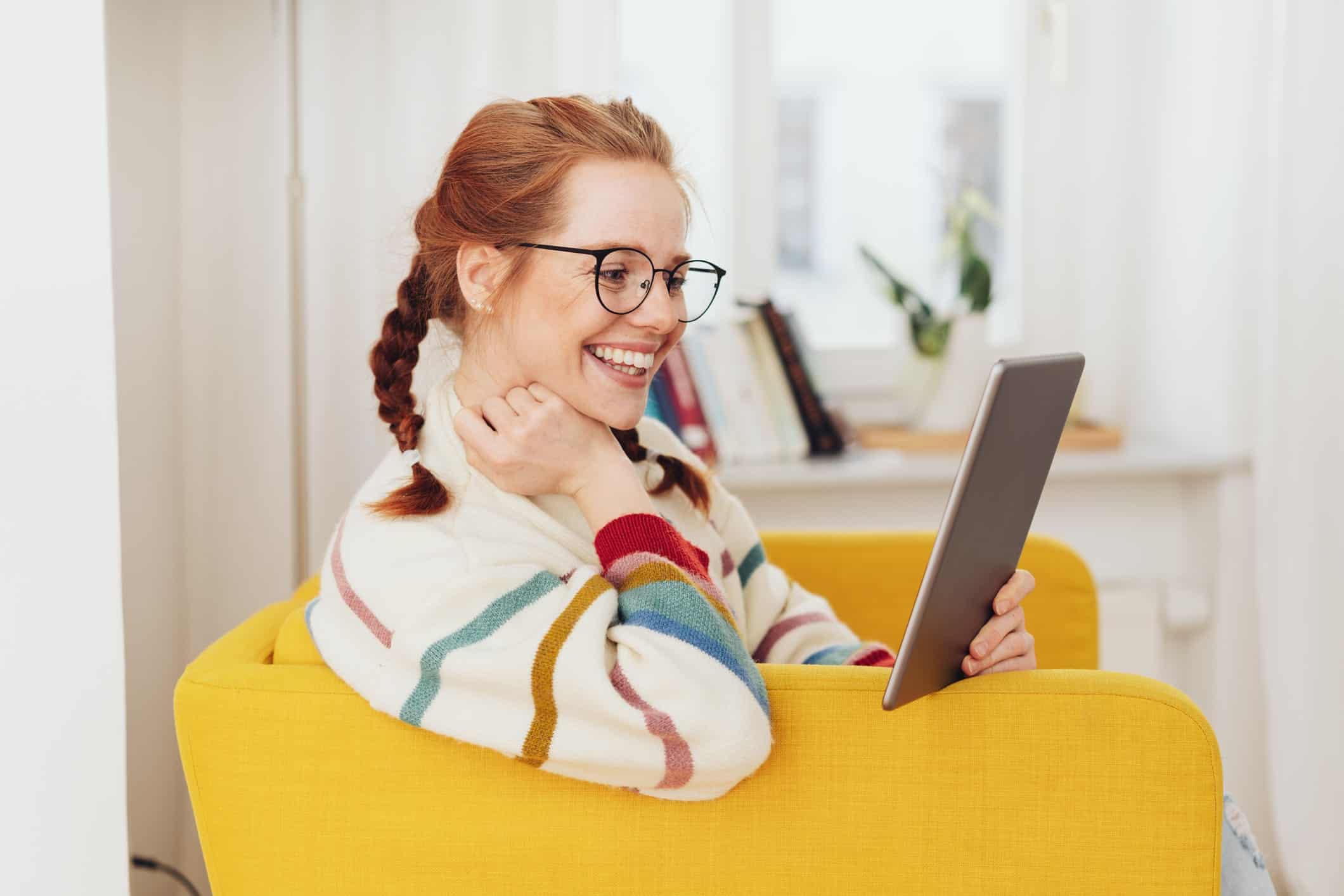DeafSpace Architektur
Architektur kümmerte sich in der Vergangenheit selten um die Zugänglichkeit der Welt für Menschen mit Behinderung. Vor allem Hörgeschädigte traten bei der Entwicklung von Ideen und bei der Umsetzung von architektonischen Konzepten in den Hintergrund. Der amerikanische Architekt Hansel Baumann entwickelte 2005 in Zusammenarbeit mit der Gallaudet Universität in Washington D.C. daher das Konzept des sogenannten “DeafSpace“.
DeafSpace ist ein architektonisches Konzept, bei dem es sich nicht nur um ein bestimmtes Design oder ein spezielles Architektur-Modell handelt, sondern um die Lebensart der hörgeschädigten Bewohner. Dabei geht es neben Architektur, Farbe und Licht um die Einrichtung, technische Geräte sowie Lichtsignale – alle Facetten des Wohnens werden berücksichtigt:
Stellen Sie sich ein Gebäude vor, in dem einzelne Stockwerke über viele Sichtachsen mit viel Glas miteinander einen Raum bilden. Stellen Sie sich Korridore mit gläsernen Ecken vor, durch die Sie sehen können, wer Ihnen entgegenkommt. Stellen Sie sich großzügige Räume vor, in denen Sitzgelegenheiten und Tische im Kreis angeordnet sind. Stellen Sie sich Farbwelten vor, die kontrastreich sind, das Auge aber dennoch entspannen. Stellen Sie sich eine Beleuchtung vor, die Räume und Gesichter gleichmäßig und ohne Schatten ausleuchtet.
Aus der Praxis entstanden
DeafSpace ist eine Idee, die sich über die Jahre hinweg verstärkt hat. Es ist wie eine Sammlung von Entwürfen und bewährten Verfahren zur Lösung typischer Alltagsprobleme. Dazu wurden über viele Jahre hinweg Menschen mit Hörbehinderung begleitet. Sie erhielten Anregungen, wie sie ihr Zuhause oder ihren Arbeitsplatz an ihre Bedürfnisse anpassen können, um Kommunikationsbarrieren zu verringern.
Zwei konkrete Beispiele
Der gehörlose Architekt Jan Philipp Koch lebt in seinem „DeafSpace Haus“ mit weitem Blick, viel Helligkeit und einer eher reduzierten Ausstattung. Der Architekt schuf einen Kommunikationsraum, eine Sichtachse zwischen dem Innen- und Außenbereich. So kann er sehen, was draußen passiert – und umgekehrt. Im gesamten Haus gibt es praktisch keine Zwischenwände, sodass keine Blickrichtung versperrt ist. Selbst die Möbel sind aus diesem Grund flexibel und drehbar.
Auch die Elbschule in Hamburg berücksichtigt einige Anregungen des „DeafSpace“-Konzepts. Unter anderem sind alle Räume sehr gut überschaubar. So gibt es beispielsweise in den Gemeinschaftsräumen keine Wände, die die Kommunikation stören könnten. Sogar die Monitore in den PC-Räumen sind in den Tisch eingebaut, damit sie die Sicht nicht einschränken. Zudem sind alle Räume mit Lichtsignalen ausgestattet. Und es gibt noch weitere Besonderheiten: Unter der Bühne in der Aula befindet sich beispielsweise ein Subwoofer, der die Bässe der Musik im Körper spüren lässt.